Prof. Dr. Armin Owzar
Maurice Halbwachs-Gastprofessur 2025/26

Foto: privat
Armin Owzar ist Professor für die Neuere und Neueste Geschichte der deutschsprachigen Länder am Département d’Etudes germaniques et franco-allemandes der Universität Sorbonne Nouvelle (Paris 3) und nimmt im Hochschulajhr 2025-2026 an der Bergischen Universität Wuppertal die Maurice Halbwachs-Gastprofessur wahr. Der Schwerpunkt seiner Forschungen liegt auf der politischen Sozial- und Kulturgeschichte Deutschlands und Frankreichs im „langen“ 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung soziokultureller Konflikte und transnationaler Austauschprozesse. In zahlreichen seiner Veröffentlichungen hat er die napoleonische Zeit in Mitteleuropa, das deutsche Kaiserreich und die Nachkriegszeit in Deutschland behandelt. Seine aktuellen Interessen gelten der modernen Stadtgeschichte, der Historischen Anthropologie, der politischen Ikonographie und den deutsch-französischen Beziehungen.
Aktuelles

Veranstaltung
Kulturberufe im deutsch-französischen Bereich (Métiers de la culture dans le domaine franco-allemand) mit Anneke Viertel.
- 05.02.2026
- 18:00 Uhr
- online unter https://meet.google.com/tkp-mwnf-wvm
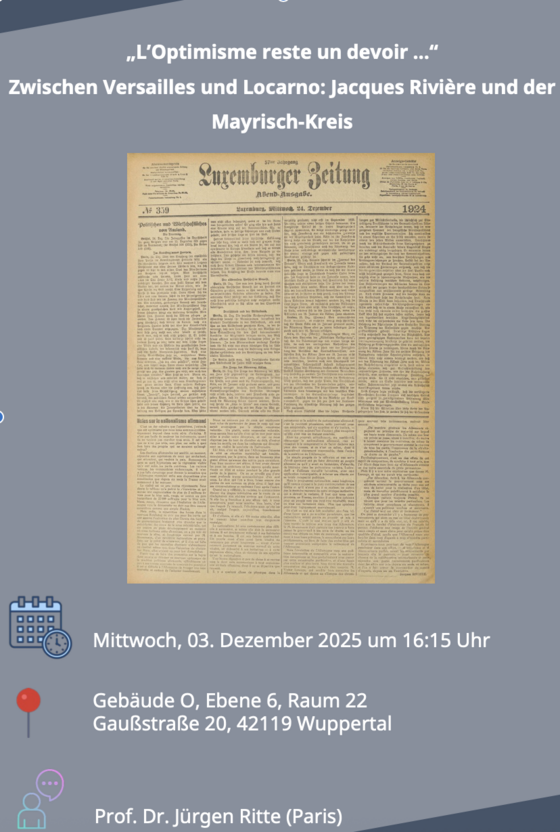
Veranstaltung
„L’Optimisme reste un devoir …“ Zwischen Versailles und Locarno: Jacques Rivière und der Mayrisch-Kreis mit Prof. Dr. Jürgen Ritte.
- 03.12.2025
- 16:15 Uhr
- O.6.22.
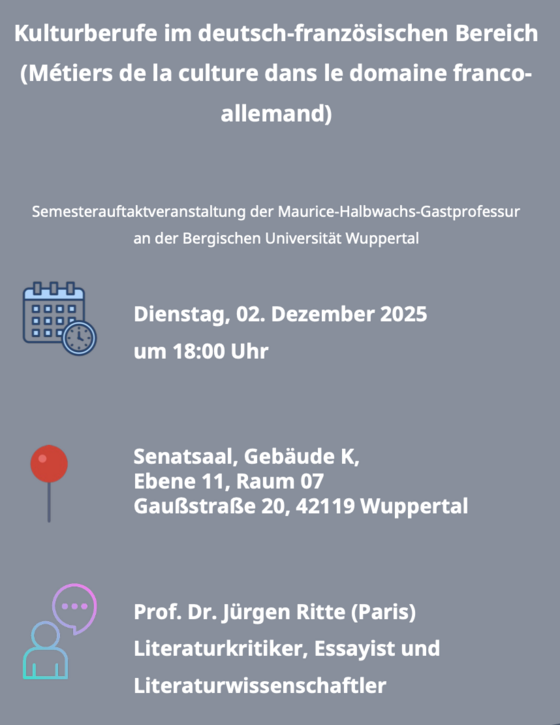
Veranstaltung
Kulturberufe im deutsch-französischen Bereich (Métiers de la culture dans le domaine franco-allemand) mit Prof. Dr. Jürgen Ritte.
- 02.12.2025
- 18:00 Uhr
- Senatsaal K.11.07

Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Owzar
„Geteilte Vergangenheit – gespaltenes Gedächtnis. Das Königreich Westphalen in deutschen und französischen Erinnerungskulturen".
- 25.11.2025
- 18.00 Uhr
- Senatsaal K.11.07.
Lehrveranstaltungen
Prof. Dr. Armin Owzar bietet im Wintersemester 2025/26 eine Vorlesung und ein Hauptseminar an.
Vorlesung
- Titel: Von der „Erbfeindschaft“ zur „Erbfreundschaft“? Die deutsch-französischen Beziehungen und Verflechtungen im 19., 20. und 21. Jahrhundert
- Zeit: MI, 14-16 Uhr
- Ort: O.06.22 (Hörsaal 18)
- Anmeldung: über StudiLöwe
Nicht ohne Grund werden die (west-)deutsch-französischen Beziehungen nach 1945 durchweg als Erfolgsgeschichte beschrieben. Das populäre Narrativ, das den Prozess der gegenseitigen Verständigung, Annäherung, Aussöhnung undKooperation bis zur Herausbildung einer gleichberechtigten Partnerschaft beider Länder zum Prototypen internationaler Zusammenarbeit stilisiert, entfaltet umso größere Wirkung, als die Vorgeschichte weitgehend als konfliktär dargestelltwird – was nicht zuletzt in der weitverbreiteten Metapher einer deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ zum Ausdruck kommt. Dass eine solche eindimensionale Sicht dem hochkomplexen Verhältnis zweier Gesellschaften nicht gerecht wird, soll in der Vorlesung mit Blick vor allem auf die politischen, sozialen und kulturellen Beziehungen und Verflechtungen herausgearbeitet werden, wobei aus einer vergleichenden Perspektive auch Prozesse langer Dauer einbezogen werden sollen. Im Mittelpunkt des ersten Teils (von 1789 bis 1945) stehen daher nicht nur die militärischen Konflikte, von den Revolutionskriegen bis zum Zweiten Weltkrieg, sondern auch die vielfältigen Formen von gegenseitiger Anerkennung, Kooperation und Transfer. Vice versa behandelt der zweite Teil (von 1945 bis 2025) nicht nur die im Rahmen der europäischen Integration vollzogene Kooperation, sondern auch die zahlreichen Irritationen, Rivalitäten und Rückschläge.
Seminar
- Titel: Bilder und Geschichtsbilder in Deutschland und Frankreich
- Zeit: Do, 10-12 Uhr
- Ort: O.14.09
- Anmeldung: über StudiLöwe
Nicht nur in Diktaturen, auch in demokratischen Systemen spielt die politische Instrumentalisierung von Geschichte zu politischen Zwecken eine nicht geringe Rolle. Laut Reinhart Koselleck sind es vor allem „die sieben Ps“: die Professoren, Politiker, Priester, Pädagogen, Poeten, Publizisten und PR-Spezialisten, die „darüber befinden, was kollektiv, was als Kollektiv zu erinnern sei“. Sie alle bedienen sich historischer Bezüge und historischer Vergleiche, um bestimmte Politiken, politische Ideen oder Ideologien zu legitimieren oder zu desavouieren. Man denke nur an die inszenierte Erinnerung an die Französische Revolution bzw. die regelmäßig vorgenommenen Verweise auf das Münchner Abkommen von 1938 oder die Gleichsetzung autoritärer Regime mit dem NS-Staat. Besonders häufig begegnen einem solche strukturellen Bezugnahmen durch eine Parallelisierung von Biographien, vorzugsweise in Form von Hitler-Vergleichen.
Bei der Konstruktion solcher Geschichtsbilder wird gerne auf Bilder im wörtlichen Sinne zurückgegriffen: mittels Fotomontagen und Filmen, Karikaturen, Zeichnungen und Gemälden werden Ereignisse re-inszeniert und historische Persönlichkeiten der Gegenwart zum Vorbild anempfohlen bzw. zeitgenössische Persönlichkeiten durch Verweise auf historische Herrscher geschmäht. Solchen Geschichtsbildern will das inter- und transdisziplinär ausgerichtete Seminar nachgehen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf jenen „Erinnerungsorten“ (Pierre Nora), die gleichermaßen in der deutschen wie der französischen Erinnerungskultur eine zentrale Rolle spiel(t)en, dabei aber eine zum Teil höchst unterschiedliche Ausdeutung erfuhren. Zum einen geht es um die Erinnerung an jene Ereignisse, die wie die sogenannte Völkerschlacht von Leipzig im Oktober 1813, die Proklamation des Deutschen Reiches in Versailles im Januar 1871 oder der Waffenstillstand von Compiègne im November 1918 vor allem nationalistisch ausgedeutet wurden. Zum anderen konzentriert sich das Seminar auf die Darstellung jener Persönlichkeiten, die wie Arminius und Vercingétorix, Charlemagne oder Napoleon in Deutschland und Frankreich auf zum Teil höchst unterschiedliche Weise erinnert wurden und werden.

